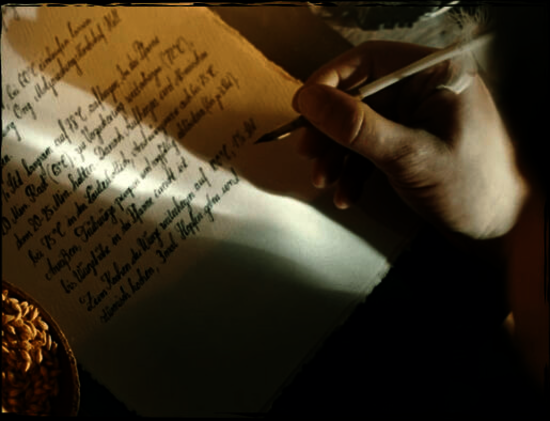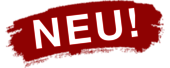Auch wenn wir es uns mittlerweile nicht mehr vorstellen können, gab es früher weder Kühlschränke noch Kühlhäuser, was das Bierbrauen problematisch gestaltete. Denn hohe Temperaturen im Sommer konnten die Gärung negativ beeinflussen und das Bier verderben lassen. Somit herrschte zwischen dem Georgitag am 23. April und dem Michaelistag am 29. September ein Brauverbot. Um die warme Jahreszeit zu überbrücken, braute man im März und April einfach noch Biere mit einer höheren Stammwürze und einem entsprechend höheren Alkoholgehalt, die bis in den Herbst hinein haltbar waren.
Demnach wurde zum Abschluss des Braujahres der Tag nach dem Michaelistag genommen, um das Brausilvester zu feiern. Am 30. September schlossen die Brauereien mit kleinen Festen, Musik, Bier und Gemeinschaft ihre Bücher, um das vergangene Braujahr zu bilanzieren und das neue zu planen.
Das neue Brauerjahr begann schließlich traditionell am 1. Oktober. Den ersten Sud braute man dann besonders sorgfältig und manchmal sogar mit einem kirchlichen Segen ein. Oft herrschte eine dem Erntedank ähnliche Stimmung, denn eine gute Ernte brachte genug frischen Hopfen und frisches Getreide für das kommende Brauerjahr und entsprechend viel Bier konnte gebraut und verkauft werden.
Auch heute noch feiert die ein oder andere Brauerei die schöne Tradition des Brausilvesters. Dazu stoßen auch wir gerne mit euch an: Auf ein gesundes, neues Brauerjahr!